Betroffene werden im Stich gelassen
In der Schweiz leiden 400’000 Menschen an einer seltenen Erbkrankheit. Ärzte sind oft ratlos. Und die Krankenkassen weigern sich zunehmend, die nötigen Gentests zu bezahlen.
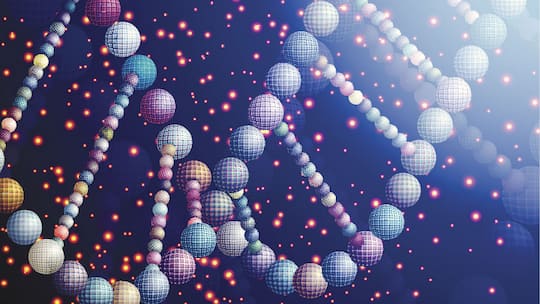
Die Hebamme nimmt den frisch geborenen Damian (Name geändert) in den Arm, da entfährt ihr der Satz: «Mit ihm stimmt etwas nicht.» Diese Worte schwirren Damians Mutter Bea Ammann (Name geändert) bis heute im Kopf herum.
Unterdessen ist Damian drei Jahre alt, ein lustiger kleiner Kerl. Doch es stimmt wirklich etwas nicht mit ihm: Die Körperhaltung ist leicht schief, die Gesichtszüge sind asymmetrisch, er schielt heftig und hinkt in der Entwicklung Gleichaltrigen stark hinterher. Die Invalidenversicherung attestiert ihm ein Geburtsgebrechen und bezahlt eine Bewegungstherapie. Woran genau Damian leidet, weiss niemand. Einzig eine genetische Abklärung könnte Aufschluss geben. Eine sogenannte Reihenhybridisierung, 2800 Franken teuer.
Doch die Krankenkasse weigert sich, diese Kosten zu übernehmen: Die «klinischen Konsequenzen» einer Genanalyse seien unklar. Mit anderen Worten: Die Kasse hält Genanalysen für unnötig, da ein genetischer Defekt – falls einer gefunden würde – meist nicht geheilt werden kann.
Es sei typisch, dass eine Genanalyse nicht bezahlt werde, da die Diagnose «nicht therapierelevant» sei. «Das nimmt in letzter Zeit dramatisch zu», sagt Humangenetikerin Sabina Gallati vom Berner Inselspital (siehe Interview). Sie ärgert sich: «Das ist diskriminierend und schlimm für alle Betroffenen.» Jeder Mensch habe ein Recht auf eine Diagnose, ein Recht darauf, zu wissen, was ihm fehlt. Denn nur wenn eine Diagnose bestehe, könne auch eine gezielte Therapie erfolgen.
Damian leidet wahrscheinlich an einer sogenannten seltenen Krankheit. Diese sind zu über 80 Prozent genetischer Natur. Eine Krankheit gilt dann als selten, wenn lediglich einer von 2000 oder mehr Menschen betroffen ist; der Verlauf ist oft chronisch, das Leiden kann zur Invalidität führen und lebensbedrohend sein. Meist tritt es bei Geburt oder im frühen Kindesalter auf. Es sind 7000 seltene Krankheiten bekannt, 6,5 Prozent der Bevölkerung leiden an einer – in der Schweiz also etwa 500’000 Menschen.
Eine halbe Million Betroffene: Das klingt nach viel. Und doch ist jeder von ihnen sehr allein, da nur wenige genau dasselbe Leiden haben. Zudem ist das Wissen über die einzelnen Erkrankungen oft dürftig, denn es gibt wegen der hohen Kosten für die kleinen Patientengruppen kaum Forschung.
Yasar Öcal und seine Frau Mukadder mussten sogar vor Gericht, um die Integration ihrer Tochter Sevin in die Regelschule durchzusetzen – und bekamen recht. Heute besucht die Achtjährige die erste Klasse in Muttenz BL. «Wir sind sehr glücklich. Aber der Weg war steinig», sagt Yasar Öcal, der vor 27 Jahren aus der Türkei in die Schweiz kam und als Drucker arbeitet.
Kurz nach der Geburt des Mädchens bemerken die Eltern, dass es keine Haut an den Füssen hat. Ärzte und Krankenschwestern sind ratlos, so etwas haben sie noch nie gesehen. Sevin wird ins Basler Kantonsspital Bruderholz verlegt, ein Facharzt diagnostiziert die Schmetterlingskrankheit, ein genetisch bedingtes Hautleiden.
Sevin hat die gravierendste Variante der Schmetterlingskrankheit, die dystrophe Epidermolysis bullosa. Vier Stunden dauert die Pflege der Wunden jeden Tag, das Wechseln der Verbände – eine schmerzhafte Prozedur für Sevin. Die Haut ist sehr verletzlich, bei der geringsten Belastung bilden sich Blasen oder Risse. Die Haut löst sich bis in die tiefsten Schichten, auch die Schleimhäute sind betroffen. Es kommt zu Narben wie bei Verbrennungen. Sevins Finger und Zehen sind verwachsen. In der Schweiz leiden nur etwa 30 Personen an dieser Form der Krankheit. Nicht mehr heilende Wunden führen zu bösartigem Hautkrebs – die meisten Betroffenen sterben vor dem 40. Geburtstag.

Sevin Öcal, 8, aus Muttenz BL, leidet an Epidermolysis bullosa (Schmetterlingskrankheit).
Kurz vor den Sommerferien 2012 teilt die Schulbehörde der Familie aus heiterem Himmel mit, dass Sevin in eine heilpädagogische Sonderschule versetzt werde – der Entscheid fällt ohne die Eltern und gegen die Empfehlungen des schulpsychologischen Dienstes. Als Grund vermutet der Vater den unerwünschten Zusatzaufwand, weil ein Kind wie Sevin mehr Hilfe braucht.
Die Eltern Öcal gehen vor Gericht, fordern, dass ihre Tochter in die Regelschule kommt. Mitte Januar 2014 gibt ihnen das Obergericht in Liestal recht; seitdem besucht Sevin die Primarschule, und es gefällt ihr «richtig gut». «Ich weiss nicht, warum Kinder wie Sevin nicht in die normale Schule gehen sollten», sagt Yasar Öcal, «es ist so wichtig für sie, nicht dauernd mit Behinderungen konfrontiert zu werden.»
Unterstützt wurde die kurdische Familie auch von Pro Raris, dem 2010 gegründeten Dachverband für seltene Krankheiten, einer Allianz von 50 Patientenorganisationen. Pro Raris gibt es in allen europäischen Ländern.
«Jemand mit einer seltenen Krankheit wird schlechter versorgt als jemand mit einer häufigeren», sagt Esther Neiditsch, Generalsekretärin von Pro Raris. «Das darf nicht sein, der rechtsgleiche Zugang zur Gesundheitsversorgung muss garantiert sein.»
Die Betroffenen stehen zwischen Pharmaindustrie und Kassen, ihre Anliegen werden oft zerrieben zwischen diesen mächtigen Playern. Pro Raris und Neiditsch, deren älteste Tochter an einer seltenen Krankheit gestorben ist, kämpfen dagegen, dass Betroffene diskriminiert werden. «Schliesslich kann niemand etwas dafür, dass er an einer seltenen Krankheit leidet. Das ist schon Schicksal genug.»
Die 32-jährige Publizistikstudentin Priya Joshi aus Zürich leidet an der Erbkrankheit Morbus Wilson. Ihr Körper kann das Kupfer, das täglich über die Nahrung aufgenommen wird, nicht ausreichend ausscheiden. Es reichert sich in Leber und Gehirn an und schädigt diese. Morbus Wilson entsteht, wenn sowohl Vater als auch Mutter Träger der Genvariante sind – und auch dann liegt die Wahrscheinlichkeit, daran zu erkranken, nur bei 1:4.
Priya Joshi schiebt die langen schwarzen Haare aus dem schmalen Gesicht und sagt: «Mein Vater stammt aus Indien, meine Mutter aus der Schweiz: Dass sie sich überhaupt treffen, ist schon ein Wunder, aber dass sie dann noch beide Träger des gleichen Gendefekts sind, das ist unglaublich.» Ihr drei Jahre jüngerer Bruder ist gesund.
Priya Joshi ist hübsch, schlank, gross. Sie wollte Tänzerin werden, hat drei Jahre in Hamburg Tanz studiert – bis es nicht mehr ging. Heute ist ihre Sprache undeutlich, ihr Gang steif und ungelenk, ein selbständiges Leben ist unmöglich. Ihre Muskeln sind verkrampft, die koordinativen Fähigkeiten stark eingeschränkt.

Priya Joshi, 32, aus Zürich, leidet an Morbus Wilson (Kupferspeicherkrankheit).
Nur durch Zufall entdeckt ein Augenarzt bei der damals Elfjährigen einen goldbraunen Ring um die Iris, entstanden durch die Kupferanreicherung. Nach Abklärungen und genetischen Tests im Kinderspital steht fest: Morbus Wilson. Da ist Priya Joshi aber noch ein ganz gesundes Mädchen, hat keinerlei Beschwerden. Die Ärzte ordnen eine medikamentöse Therapie an.
Die starken Medikamente haben unangenehme Nebenwirkungen, ihr ist oft übel. Kurz vor dem 18. Geburtstag muss sie den Arzt wechseln, da sie fürs Kinderspital zu alt ist. Gleichzeitig werden die starken Medikamente durch schwächere ersetzt, mit weniger Nebenwirkungen. Ein Fehler, wie sich später zeigen wird.
Nach der Rückkehr aus Hamburg fängt die junge Frau ein Publizistikstudium an. Sie nimmt stark ab, wiegt bei 1,79 Meter Grösse noch 40 Kilo. Ihre Schrift wird immer zittriger, sie ist ständig müde, schläft während der Vorlesungen ein. Als sie kaum mehr gehen kann, bringt die Mutter sie ins Unispital. Das angesammelte Kupfer hat in ihrem zentralen Nervensystem Schäden angerichtet. Der Medikamentenwechsel mit 18 war fatal, wenn sie weiter die starke Variante bekommen hätte, ginge es ihr heute besser. Dem damaligen Arzt will sie keinen Vorwurf machen – ihm fehlte wohl das Know-how für den Umgang mit der Krankheit, von der in der Schweiz weniger als 200 Personen betroffen sind.
Joshi hat Angst vor der Zukunft. Den Kinderwunsch hat sie jedenfalls schon begraben. Sie hofft, dass weitergeforscht wird zu Morbus Wilson, dass vielleicht doch noch ein Medikament gefunden wird, das ihr besser helfen kann.
Hoffen muss sie auch, dass sie ein solches dann auch bekommen würde. Denn 2010 fällte das Bundesgericht ein wegweisendes Urteil – in der Frage der Medikamentenvergütung eine Zäsur: «Lausanne» entschied, dass jährlich über 500’000 Franken zu viel seien, um einer an der Stoffwechselkrankheit Morbus Pompe leidenden Patientin Linderung zu verschaffen; maximal 100’000 Franken pro gerettetes Lebensjahr seien «noch als angemessen zu betrachten», schrieben die Richter.
Hinter dem Urteil steht ein Interessenkonflikt: Die Pharmafirmen bieten wohl immer mehr Medikamente gegen seltene Krankheiten an, verlangen dafür aber wegen der hohen Entwicklungskosten und des kleinen Absatzmarkts horrende Preise. Auf der anderen Seite wollen die Krankenkassen – und dahinter die Prämienzahler – diese teuren Präparate möglichst nicht auf der sogenannten Spezialitätenliste haben, weil das zur Übernahme der Kosten verpflichtet.
Ausgetragen wird das Seilziehen auf dem Buckel der Betroffenen, denen so lebenswichtige Medikamente vorenthalten bleiben. Das böse Wort der «medizinischen Rationierung» steht im Raum.
Doch es kommt Bewegung in die Sache: 2011 wurden zwei Zusatzartikel in Kraft gesetzt, die unter bestimmten Bedingungen Kostengutsprachen auch für Arzneimittel ermöglichen, die nicht auf der Spezialitätenliste stehen. Laut einer aktuellen Evaluation hat das gerade Betroffenen von seltenen Erkrankungen mehr Rechtssicherheit gebracht. Von jährlich 6000 bis 8000 Gesuchen um Kostengutsprache nach den neuen Artikeln (71a und 71b KVV) wurden mehr als drei Viertel gutgeheissen.
Die Politik foutierte sich lange um die Problematik. Doch dann wurde insbesondere die Aargauer CVP-Nationalrätin Ruth Humbel aktiv. Sie präsidiert die IG Seltene Krankheiten, eine Lobbygruppierung, die – anders als die Patientenorganisation Pro Raris – auch mit der Pharmaindustrie sowie Vertretern von Spitälern und Ärzteschaft verbandelt ist.
Einer von Humbels Vorstössen, Ende 2010 im Windschatten des heftig debattierten Bundesgerichtsurteils eingereicht, steht jetzt kurz vor der Realisierung: Das Bundesamt für Gesundheit hat das «Nationale Konzept seltene Krankheiten» erarbeitet. Es wird diesen Herbst dem Bundesrat unterbreitet.
Sobald die politischen Instanzen das Konzept genehmigt haben, werden konkrete Massnahmen erarbeitet. Ob dafür Gesetzesänderungen nötig sind, ist offen. So oder so wäre die Schweiz spät dran: Die USA und die EU erliessen schon im Jahr 1983 beziehungsweise im Jahr 2000 Gesetze zur Erforschung und Behandlung von seltenen Krankheiten.
Fachleute wie die Humangenetikerin Sabina Gallati geben dem Konzept des Bundes gute Noten, es erfasse die wesentlichen Handlungsfelder. Betroffene dürfen hoffen – im Einzelfall nützt ihnen allerdings auch die beste Strategie nichts, wenn wichtige Player nicht mitspielen.
Weitere Infos
Patientenorganisation in der Schweiz für Menschen mit Epidermolysis bullosa: www.schmetterlingskinder.ch
Mehr zum Thema «Seltene Krankheiten»
«Vom Arbeitgeber im Stich gelassen»: Beat Bachmann konnte die neuen Pläne seines Arbeitgebers nicht mehr erfüllen und erhielt - nach 23 Jahren - die Kündigung.



