Falsche Arztrechnungen kosten uns Hunderte Millionen Franken
Bei Rechnungen gilt eine Art Vertrauensprinzip – das wird teuer für die Prämienzahlenden. Die fehlbaren Ärztinnen und Ärzte haben wenig zu befürchten.

Veröffentlicht am 17. Februar 2025 - 09:49 Uhr

Das Echo war gewaltig: Weit über 200 Leserinnen und Leser meldeten sich beim Beobachter. Sie erzählten von Ärzten, die nie erbrachte Leistungen abrechneten, von nicht durchgeführten Konsultationen und von doppelt verrechneten Operationen.
Dank wachsamer Patientinnen und Patienten werden solche Fehler meist nach Reklamationen korrigiert, was Krankenkassen – und somit uns allen – im Einzelfall oft Hunderte, manchmal sogar Tausende Franken spart.
Erzählen Sie uns Ihre Geschichte!
Mal sind es kleine Fehler, manchmal sind es groteske Irrtümer. Etwa im Fall eines Jugendlichen, dem nach einer Knieuntersuchung im Kantonsspital Graubünden ein Paar Gehstöcke ausgehändigt wurden. Verrechnet wurden aber 75 Paar Krücken. Hätte die Mutter des Jugendlichen die Rechnung nicht hinterfragt, hätte die Krankenkasse den Betrag anstandslos bezahlt.
Vertrauensvorschuss für den Arzt
Prämienzahlerinnen und -zahler ärgern sich aber auch über ihre Krankenkassen. Wer einen Fehler meldet, wird oft abgewimmelt. Man erklärt ihnen, dass eben das Vertrauensprinzip gelte, und wenn ein Arzt auf der Rechnung eine Position aufführe, werde das auch vergütet.
Wer als Arzt oder Ärztin falsch abrechnet, hat ohnehin wenig zu befürchten. Zwar haben die Krankenkassen ihre internen Kontrollen in den letzten Jahren stets verbessert. Mit Algorithmen überprüfen sie die Tarifpositionen auf Arztrechnungen grösstenteils automatisiert – und finden damit im grossen Stil Unregelmässigkeiten.
Unentdeckte Fehlbeträge in dreistelliger Millionenhöhe
Gemäss dem Krankenkassenverband Santésuisse werden jährlich rund drei Milliarden Franken korrigiert und folglich nicht ausgegeben. Schätzungen deuten aber darauf hin, dass trotz der standardisierten Kontrollen ein hoher dreistelliger Millionenbetrag unentdeckt bleibt.
Das Problem: «Die Krankenversicherung kann nicht wissen, wie eine Konsultation genau abgelaufen ist», sagt Irit Mandel von Santésuisse. Deshalb ergebe es Sinn, wenn Patientinnen und Patienten bei einem Fehler in der Abrechnung zuerst direkt auf den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin zugehen. Kommt keine Einigung zustande, kann eine Krankenkasse den Arzt zur Korrektur oder zu einer Stellungnahme auffordern.
Rechnungskopien sind kaum verständlich
Bis vor drei Jahren hatten Patientinnen und Patienten schlicht keine Ahnung, was ein Arzt oder eine Ärztin für eine Konsultation überhaupt verrechnete. Seither sind Arztpraxen und Spitäler verpflichtet, den Versicherten eine Rechnungskopie zuzustellen.
Doch für Versicherte sind die Rechnungen oft kaum zu entziffern. Diese sind gespickt mit Codes für «Tarife», «Tarifziffern» und «Bezugsziffern», mit unverständlichen Abkürzungen, medizinischen Fachbegriffen und nicht nachvollziehbaren Kurzerklärungen.
«Heute sind die Rechnungen viel zu wenig transparent und oft für Patienten schwer verständlich.»
Irit Mandel, Santésuisse
«Ich konnte die Rechnung nicht nachvollziehen», sagt Rolf Matter, der richtig anders heisst und sich vor einem Jahr einer Darmspiegelung unterziehen musste. Schliesslich realisierte er allein aufgrund der aufgeführten Daten, dass das Spital einen Monat später eine zweite Darmspiegelung verrechnete, die gar nie stattgefunden hat. Santésuisse-Sprecherin Irit Mandel bestätigt: «Heute sind die Rechnungen viel zu wenig transparent und oft für Patienten schwer verständlich.»
Dazu kommt: Wer bei seiner Ärztin wegen einer Rechnung reklamiert, macht sich unbeliebt. Mehrere Leser berichten dem Beobachter, wie sie nach einer Reklamation vom Hausarzt unverblümt aufgefordert worden seien, eine andere Praxis zu suchen.
Wirksam, zweckmässig, wirtschaftlich?
Das Krankenversicherungsgesetz verlangt zwar von Ärztinnen und Ärzten, dass die abgerechneten Leistungen «wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich» sind. Verstossen Ärzte, Spitäler und andere Leistungserbringer dagegen, können Krankenkassen bereits bezahlte Leistungen zurückfordern.
Doch wie soll eine Krankenkasse einem Arzt nachweisen, dass er «unwirtschaftlich» arbeitet? Das Bundesgericht kam verschiedentlich zum Schluss, dass eine «Überarztung» vorliege, «wenn ein Arzt […] im Durchschnitt erheblich mehr verrechnet, ohne dass er Besonderheiten geltend machen könnte, die den Durchschnitt beeinflussen».
Liegt ein Arzt 30 Prozent über dem errechneten Mittelwert einer Vergleichsgruppe, macht er sich verdächtig.
Klingt nachvollziehbar, ist aber schwierig zu belegen. Krankenversicherungen und Ärzte einigten sich zwar auf eine «Screening-Methode», um für jeden Arzt einen «Gesamtkostenindex» zu berechnen. Liegt ein Arzt 30 Prozent über dem errechneten Mittelwert einer Vergleichsgruppe, macht er sich verdächtig.
Doch eine tatsächliche «Überarztung» nachzuweisen, bleibt auch dann noch schwierig. Denn eine «verdächtige» Ärztin kann sich beispielsweise für ihre hohen Kosten rechtfertigen, wenn sie besonders viele ältere Patientinnen und Patienten betreut, die aufgrund ihrer Krankheiten öfters die Praxis besuchen und mehr Aufwand generieren.
Die Krux mit der «Einzelfallprüfung»
Sogar wenn ein Arzt mit seinem Gesamtkostenindex weit über dem Toleranzwert liegt, ist juristisch noch nicht belegt, dass er auch unwirtschaftlich arbeitet. Vor drei Jahren beispielsweise strengten 26 Krankenkassen ein Verfahren gegen einen Berner Arzt an, der sich mit hohen Kosten verdächtig gemacht hatte. Und dies nicht zum ersten Mal. Bereits zwei Jahre zuvor hatte er den Versicherungen nach einem aussergerichtlichen Vergleich 500’000 Franken zurückerstatten müssen.
Im neuen Fall kam das kantonale Schiedsgericht zu einem ähnlichen Schluss, der Arzt sollte für das Jahr 2017 rund 267’000 Franken zurückzahlen.
Der Beobachter-Prämienticker
Der Prämienticker schaut Lobbyisten und Profiteuren des Gesundheitswesens auf die Finger, deckt Missstände auf und sammelt Erfahrungen von Patienten, die unnötige Ausgaben vermeiden konnten.
Klicken Sie auf den Ticker oder hier, um mehr zu erfahren.
Doch vor knapp einem Jahr hob das Bundesgericht den Entscheid auf. Die Begründung: Es reicht nicht, dass die Krankenkassen einfach nur mit der «Screening-Methode» nachweisen, dass ein Arzt einen zu hohen Gesamtkostenindex aufweist. Das Bundesgericht kommt zum Schluss, die Krankenkassen hätten beim Arzt auch noch eine «Einzelfallprüfung» vornehmen müssen. Was genau das Bundesgericht darunter versteht, ist nicht klar.
Fast schon erstaunlich, dass es in seltenen Fällen dennoch gelingt, notorische Falschabrechner zu stellen. Im Kanton Bern wurde vor einem Jahr eine Psychiaterin unter anderem wegen gewerbsmässigen Betrugs und Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten verurteilt, 12 Monate davon muss sie absitzen. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.
Psychiaterin rechnete für die Heilpraktikerin ab
Über mehrere Jahre hatte die Psychiaterin den Krankenkassen Leistungen verrechnet, die nicht sie selbst erbracht hat, sondern ihre Lebenspartnerin, eine Heilpraktikerin. Diese führte in der Praxis der Psychiaterin Hypnose, autogenes Training und Klangschalentherapien durch, die von den Krankenkassen nicht bezahlt werden.
So kassierte die Psychiaterin von den Krankenkassen Geld, das sie dann ihrer Partnerin weiterleitete. Auch diese wurde vom Regionalgericht Bern-Mittelland unter anderem wegen gewerbsmässigen Betrugs und Urkundenfälschung verurteilt. Von der Freiheitsstrafe von 28 Monaten muss sie 10 Monate absitzen. Ihr Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig, das Obergericht des Kantons Bern wird über den Fall befinden.
Vom Verdacht bis zur Verurteilung dauerte es schier unglaubliche zehn Jahre. Ins Rollen kam der Fall, als sich eine Versicherte bei der Visana beschwerte, sie habe die Hälfte ihrer Behandlungen nicht bei der Psychiaterin in Anspruch genommen, sondern bei der Entspannungstherapeutin.
Der Visana fielen danach noch andere Versicherte auf, die zur Behandlung bei der Heilpraktikerin waren, die Leistungen aber über die Psychiaterin abgerechnet wurden. Später kamen Fälle von anderen Krankenkassen hinzu. Vor Gericht traten schliesslich 13 Krankenkassen als Privatkläger auf.
Stossend an der ganzen Sache – und auch das zeigt dieser Fall exemplarisch: Wer Falschabrechner entlarvt, wird am Ende nicht etwa belohnt, sondern bestraft. Denn hätten sich die Patientinnen nicht beschwert, wären die Psychiaterin und die Heilpraktikerin nie überführt worden – und die Krankenkassen hätten die als psychiatrische Behandlung getarnten Klangschalentherapien anstandslos bezahlt. Stattdessen mussten die Patientinnen die Rechnungen selbst bezahlen.
- Bundesgericht: Urteil 9C_67/2018 (20.12.2018)
- Bundesgericht: Urteil 9C_135/2022 (12.12.2023)
- Bundesgericht: Urteil 9C_126/2023 (4.3.2024)
- Bundesgericht: Urteil 9C_201/2023 (3.4.2024)
- Regionalgericht Bern-Mittelland: Urteilsbegründung PEN 22 821 BAN (28.11.2023)
- Santésuisse: Wirtschaftlichkeitsprüfungen, 10-Jahres-Reporting 2014–2023





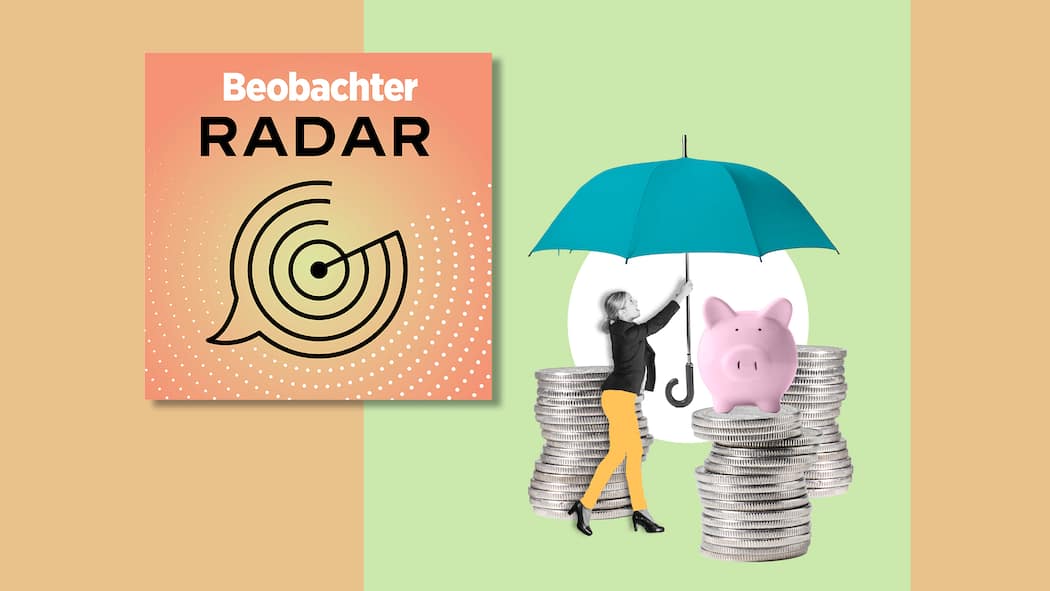





7 Kommentare
Die Aerzte wissen, dass sie fast nichts zu befürchten haben wegen dem Kontraktionszwang der Kassen. Der wird übrigens gerade jetzt im Parlament diskutiert. Grössere Kassen leisten sich Kontrollabteilungen betreffend Arztrechnungen. Man rechnet z.B. die mittleren Kosten/Patient/Arzt über einen Zeitraum aus. Liegt nun ein Arzt dauernd im oberen Bereich oder gar ausserhalb der Normalverteilung, wird er kontaktiert und darauf hingewiesen. Sinken die Kosten nicht, kann die Kasse nichts machen ausser wieder mahnen. Es herrscht eben Kontraktionszwang und so ändert sich nichts.
Als das KVG vor knapp 30 Jahren in Kraft trat, meinten es die Politiker und der Bundesrat in Person von Frau Dreifuss gut. Man bestimmte, der Patient müsse immer eine Rechnungskopie erhalten zur Kontrolle. Dann zeigte sich: Die Kopien kamen oft nicht. Wenn sie kamen, verstand sie niemand, zu kompliziert. Und selbst wenn man etwas Unrichtiges entdeckte, traute man sich nicht, den Hausarzt zu belästigen, den Facharzt schon gar nicht. Die Patientenkontrolle blieb ein frommer Wunsch. Aber auch die Kassen kontrollieren wenig bis gar nicht. Und das wissen gewisse Ärzte und nützen das aus. Da kann man leicht 2-300.- jeden Tag ungerechtfertigt in Rechnungen schmuggeln, Tarmed macht's möglich. Daneben passieren auch mal Fehler selbst wenn ehrlich verrechnet wird, was Gott sei Dank meist der Fall ist.
Bei rund 18 Millionen Konsultationen im Jahr - ohne Spitäler!- sind 200 Rückmeldungen über falsche Rechnungen jetzt nicht die angekündigte Katastrophe. Auch wenn man das mit einer Dunkelziffer multipliziert.
Wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Die 75 verrechneten Krücken z.B. sind sicherlich keine Absicht.
Genau deshalb wurde übrigens im Kanton Luzern immer schon darauf gepocht, dass der Patient die Rechnung bekommt, und nicht die Krankenkasse (Tiers garant). Der Patient ist Verursacher der Kosten, er soll diese auch überprüfen können. Und dafür gerade stehen.
Dass die Rechnungen sich dermassen kompliziert präsentieren, ist übrigens den Krankenkassen zu verdanken. Sie haben vor 20 Jahren vorgeschrieben, wie die TARMED-Rechnung auszusehen hat. Auch wenn die santésuisse sich heute öffentlich darüber beklagt, sie ist nicht unschuldig.
Und noch was: Als Leistungserbringer und Rechnungsüberprüfer der paritätischen Kommission weiss ich: Genauso, wie gewisse Leistungen falsch zu viel verrechnet werden, werden Leistungen manchmal nicht erfasst, gehen vergessen oder werden falsch zu tief erfasst. Die angeblich zu viel verrechneten Millionenbeträge stimmen also nicht wirklich und sind nur die halbe Miete.
Im Kt. Zürich wird immer mehr nach Tièrs payant abgerechnet. Man kann annehmen, dass die Ärzte so wissen, dass sicher bezahlt wird wie üblich bei Krankenkassen. Ich habe kürzlich in der Bekanntschaft mal rumgefragt, wer seine Arztrechnungen anschaut, kontrolliert. Ergebnis: Niemand. Man sprach von Vertrauen. Das ist der Punkt. Die 200 gemeldeten Beanstandungen dürften deshalb nicht einmal die Spitze des Eisbergs sein..
Aha…..so ist das also????? Da bin ich mir nicht so sicher…..denn ich habe meine eigenen Erfahrungen mit meinem ehemaligen Hausarzt gemacht…..und diese waren gar nicht schön aus finanzieller Sicht!!
Auf der einen Seite gibt es leider diese schwarzen Schafe, die ungerechtfertigte Positionen abrechnen (wie übrigens in allen anderen Berufen auch). Auf der anderen Seite müssen Ärzte ständig unter dem Damoklesschwert der Rückforderungen agieren. 5 Jahre zurück können die Krankenkassen abgerechnete Leistungen wieder zurückfordern die eben häufig auch im besten Interesse der Patienten durchgeführt wurden. So werden teils Leistungen nicht vergütet, die eigentlich medizinisch indiziert und von den Fachgesellschaften empfohlen sind. Das wiederum führt u.a. zu langen Diskussionen mit Patienten, die verständlicherweise dies schwer nachvollziehen können (und auch diese Diskussionen können nicht abgerechnet werden. Aber den Patienten einfach das Wort abzuklemmen, ist ja auch keine Lösung).